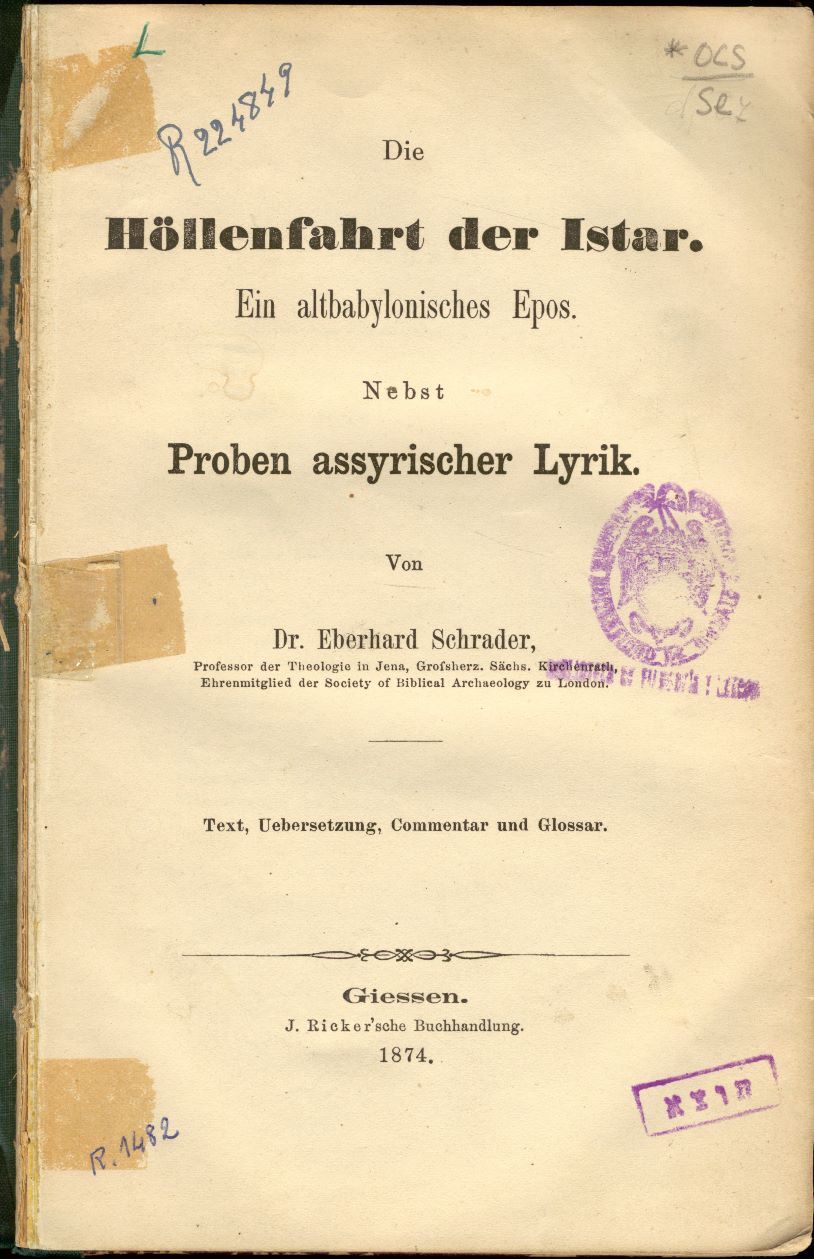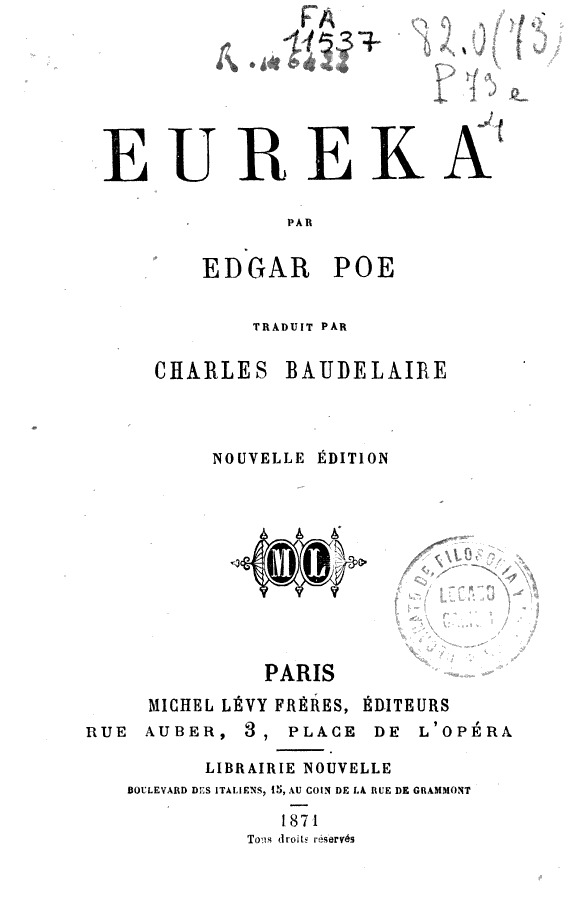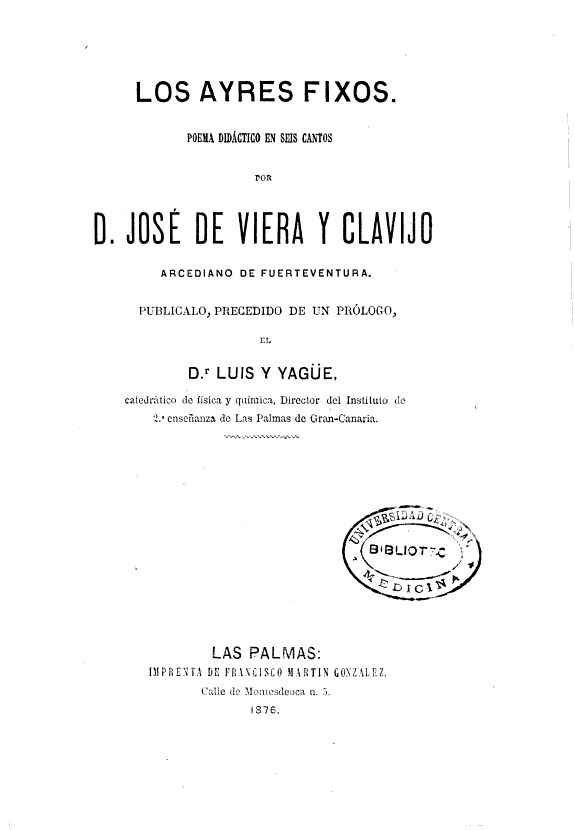Die Höllenfahrt der Istar : ein altbabylonisches Epos ; nebst Proben assyrischer Lyrik
Ver datos completos ↓
- Tipo
- libro
- Fecha
- 1874
- Formato
- image/jpeg
- application/pdf
- Idioma (código)
- ger
- Otro título
- Ishtar's descent to the nether world
- Titular de los derechos
- Universidad Complutense de Madrid
- Núm. páginas
- 153 p
- Miniatura
- https://patrimoniodigital.ucm.es/r/thumbnail/473254
- Notas
- Ex libris en hebreo. - Ingresó en la Biblioteca Histórica procedente de la Facultad de Filología en 2017. - Encuadernación de cartón
- Derechos de acceso
- Ver todo fichas con este valorCC BY 4.0
- Colección de la edición
- Impresos (Siglo XIX)
- Impresor
- Schrader, Eberhard, 1836-1908
- Lugar de publicación
- Giessen
- Signatura
- BH FLL 49052
- Identificador BUC
- 5330598164
- Idioma
- Alemán
- Europeana Type
- TEXT
- Europeana Data Provider
- Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid